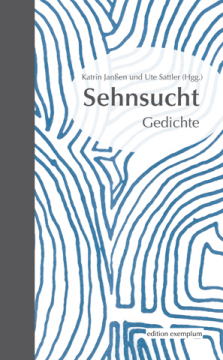Martin Roemer, geb. 1958 in Hamburg, freier Schriftsteller und Komponist, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Geschichte in Hamburg und Tübingen, lebt seit einigen Jahren in Brunsbüttel. Lyriker und Essayist, Grenzgänger zwischen Sprache und Musik. Lesungen im deutschen Sprachraum. Zahlreiche Reisen vor allem kreuz und quer durch Europa. Langjährige Verbundenheit mit Italien.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf www.martin-roemer.eu
Downloads
Weitere Leseproben finden Sie auf den jeweiligen Buchseiten.
Martin Roemer im Interview zu seinem Buch »Mit der Seele geschaut«
Lieber Herr Roemer, soeben ist Ihr neustes Buch »Mit der Seele geschaut« erschienen. Was erwartet die Lesenden?
Martin Roemer: 80 Meditationen, Ausdeutungen, Bildbetrachtungen in lyrischer Form. Ich habe mir in Büchern, im Internet, auch mein Gedächtnis an Museumsbesuche abrufend, die ausgewählten Objekte lange angeschaut und gewartet, welcher Impuls sich regt, und bin ihm dann gefolgt. Meist ging es dann irgendwann ganz rasch, und manche Texte sind in einem Flow entstanden, wie ich ihn bisher selten kannte. Da man, auch wenn man seine Bilder spontan erfasst, sowohl mit Friedrichs Gemälden als auch mit meinen Gedichten besser umgehen kann, wenn man über Zusatzinformationen verfügt, habe ich die sieben Essays geschrieben. In ihnen erfährt man das Wichtigste über den Künstler, sein Werk und seine Zeit. Wunderschön wäre es, wenn Menschen mit meinem Bändchen in der Hand durch die Museen wandern würden oder dort einmal Lesungen vor Friedrichs Bildern stattfinden könnten.
Komplettes Interview lesen
250 Jahre Caspar David Friedrich – das ist der Anlass Ihres Buches. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kontakt mit dem Werk Friedrichs?
M. R.: Das habe ich im Buch beschrieben: Ein Plattencover mit seinem ›Großen Gehege‹ bei Dresden als Kind, und ganz bewusst und intensiv mit sechzehn Jahren als Gymnasiast die große Jubiläumsausstellung 1974 in der Hamburger Kunsthalle. Sie hat mich so sehr bewegt, dass Anfang der 1980er Jahre bei den ersten Schreibversuchen auch einige durch Friedrichs Gemälde inspirierte Gedichte entstanden sind. Eines davon findet sich unverändert im Buch, ein weiteres leicht überarbeitet, und schließlich stecken im Vorspann über das ›Wesen des Schönen‹ etliche Zeilen daraus.
Sie verbinden in Ihrem Buch Ihre Gedichte mit ausgewählten Gemälden Caspar David Friedrichs. Gibt es ein Gemälde, das Sie besonders inspiriert hat?
M. R.: Sehr lange habe ich 1974 vor Friedrichs ›Ziehenden Wolken‹ gestanden, in denen ich die Sehnsüchte, Unklarheiten, Stimmungswechsel und den Wunsch nach Überblick meines damaligen Lebensalters widergespiegelt fand. Wie der Maler Gefühlsweite und -tiefe in solch ein kleinformatiges Bild hat hineinlegen können, ist großartig. Die Farben bezaubern, die Komposition ist perfekt. Bildgröße und Verweildauer des Betrachters stehen in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander: Es ist alles gesagt, doch des Deutens kein Ende.
In welchem Verhältnis stehen Malerei und Poesie Ihrer Meinung nach?
M. R.: Man kann sich ja mit Hilfe des QR-Codes, der zu Anfang des Buches abgedruckt ist, nahezu alle Bilder auf meiner Website anschauen, sofern sie sich nicht hinten im Buch finden. Bei mir habe ich dann Wikimedia Commons-Bilddateien gesammelt. Aber vielleicht ruft das eine oder andere Gedicht auch so schon beim Lesen ganz eigene – vielleicht auch andersartige – Bilder in den Köpfen der Leserschaft hervor. Natürlich versuchen die meisten Gedichte, wo sie nicht kontrafaktisch zum Bild als Dystopien verheerter Umwelt gearbeitet sind, den Gemälden und ihrem Gehalt nachzuspüren. Mit Worten lässt sich allerdings nur begrenzt »malen«, ihre Klangpalette ist etwas anderes als der Farbauftrag des Malers, und gleichzeitig »redet« ein Bild in einer Sprache, die sich nicht in Worten erschöpft.
Gibt es etwas, das Sie zum Abschluss noch sagen möchten?
M. R.: Drei Aspekte waren mir beim Schreiben wichtig: Ich wollte es zum einen nicht bei einem bloßen ›50 Jahre mit Friedrich‹ belassen, sondern auch verdeutlichen, wo und wie sich der Blickwinkel des Alternden verändert hat. Zweitens lag mir am Herzen, den religiösen Gehalt nicht zu überspielen, sondern ernst zu nehmen, und das passt ganz gut zu einem Literaten, der die Sechzig inzwischen deutlich überschritten hat. Hoffnung und Verzweiflung angesichts des nahenden Lebensendes – beides hat Friedrich auch gekannt und macht einen guten Teil seiner Bildtiefe aus. Drittens schließlich kann ich Sehnsucht, Melancholie und, ja, auch den Frieden seiner Bilder nicht betrachten, ohne an die Kriege von heute und vor allem an die heraufziehende Klimakatastrophe zu denken. Friedrich war mehr Künstler als Tatmensch, aber so leichtfertig mit der Klimakrise umzugehen, wie wir alle das bis hin zu unserer Regierung tun, hätte ihm völlig ferngelegen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview einklappen
Martin Roemer im Interview zu seinem Buch »Und wenn die Welt voll Teufel wär«
Lieber Herr Roemer, soeben ist Ihr neustes Buch »›Und wenn die Welt voll Teufel wär‹ Putins Terror – Kiews Recht« erschienen. Was erwartet die Lesenden?
Martin Roemer: Eine fundierte Auseinandersetzung mit den Gründen dieses Krieges, seinem Charakter und seinen Folgen unter Einbeziehung der wesentlichen Fachliteratur. Im Ergebnis eine entschiedene Parteinahme für die Ukraine ohne deren Verklärung und eine Philippika gegen Putins Russland. Durch die Emotionalität der Gedichte unternehme ich zugleich den Versuch, unserer Gefühlswelt ein Ventil zu verschaffen. Diese Gespaltenheit, Krieg fürchterlich zu finden und dennoch tatkräftig der angegriffenen Ukraine zur Seite zu stehen, müssen wir aushalten und spiegelt sich in der doppelten Gestaltung des Buchs. Niemand entkommt diesem Krieg, nur weil er ein paar hundert Kilometer weiter entfernt seinen Friedensalltag verbringt, und keine Haltung bleibt folgenlos. Auch wer seine Reinheit wahren möchte, indem er passiv danebensteht, kommt nicht ohne Schuld davon. Es sei denn, er findet es richtig, einfach stillschweigend zuzuschauen, wenn jemand in der U-Bahn zusammengeschlagen wird, oder schamhaft sein Köpfchen davor weg zu drehen.
Komplettes Interview lesen
Wie kam es zu Ihrer intensiven Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine?
M. R.: Sehr spontan im Gefühl, dass hier unser aller Zukunft auf dem Spiel steht. Wann wird man im Leben schon einmal so überrascht? Dieser Epochenbruch gefährdet alles, womit ich als Nachkriegskind groß geworden bin. Die aktive Drohung mit einem Atomkrieg ist ungeheuerlich. Der Klimawandel, um den sich alle Welt eigentlich vordringlich kümmern müsste, bringt Kriegsgefahr genug mit sich. Umso wichtiger ist es, dass das Regelwerk hält und die internationale Ordnung nicht auseinanderfliegt. Ich habe versucht, nicht tagesaktuell zu schreiben, sondern das Prinzipielle des Konflikts zu betonen. Unsere Enkel sollten in Freiheit leben können, statt KI-gesteuert in einer Welt »alternativer Fakten« in Reih und Glied geführt als Terrakotta-Armee zu erstarren.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, das Geschehen in der Ukraine in Form von Lyrik und Essays zu kommentieren?
M. R.: Um dem Widerspruch zwischen der Ratio, die weiß, dass dieser Krieg jetzt nicht enden darf, weil sonst die Ukraine untergeht, und dem Wunsch, er möge am besten gestern enden, Ausdruck zu verleihen. Das Ventil der Lyrik hat es mir ermöglicht, für die Analyse einen freien und klaren Kopf zu behalten. Die Essays sind tagsüber entstanden, viele Gedichte nachts, bis das bedrängende Bild mich losließ, nachdem es in Gedichtform ›gefasst‹ worden war – im doppelten Sinne des Wortes.
Was hat Literatur einer Welt voller Kriege entgegenzusetzen?
M. R.:Worte als geistige Waffe: Daniil Charms hat gesagt, ein Gedicht müsse man so schreiben, dass das Glas zerbräche, würfe man den Text durchs Fenster. Analysen, die klar schlussfolgernd alles benennen, was sich erkennen lässt, ohne etwas zu verheimlichen. Wer schreibt und sich überhaupt dem Schrecken zuwendet, statt sich vergeblich in einem provisorischen Versteck zu verkriechen – denn ein anderes gibt es nicht –, bleibt nicht nur passiv ausgeliefert, sondern wird aktiv. So wie es half zu wissen, wie ein Virus funktioniert, hilft es uns jetzt, mit Herz und Verstand zu begreifen, was Putins Russland vorhat. Wenn Sie mal Strauße gefüttert haben, die ja angeblich den Kopf in den Sand stecken, haben Sie in ziemlich dumme Gesichter geschaut. Anders als im heutigen Russland hat bei uns Literatur die Chance, Menschen zu erreichen und zum Nachdenken zu bringen. Wer sein Volk liebt, habe ich geschrieben, der will auch, dass es denkt.
Lieber Herr Roemer, was möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen?
M. R.: Jede und jeden, der das Buch zur Kenntnis nimmt und liest, möchte ich bitten, andere darauf aufmerksam zu machen. Ich freue mich auf lebhafte Diskussionen, denn nach einem Jahr Arbeit an diesem Buch glaube ich mich gut gerüstet für jedes Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview einklappen
Martin Roemer im Interview zu seinem Buch »Auf Sternengang«
Lieber Herr Roemer, soeben ist Ihr neuestes Buch »Auf Sternengang. Reisen nach Innen« erschienen. In einem Satz: Was erwartet die Lesenden?
Martin Roemer: Eine in der Corona-Zeit entstandene umfassende Selbstbefragung, wie ich über zentrale Lebensthemen denke. Ich wollte meine Positionen so intensiv formulieren, dass man darüber nur sinnvoll diskutieren kann, indem andere ebenfalls etwas ganz Persönliches von sich preisgeben. Die – abgesehen vom Zusammensein mit meiner Frau – große Einsamkeit in der Pandemie führte ohnehin zur Konzentration auf solche Themen: Corona, Klimawandel und Demokratie; Krieg und Flucht; Terror und Angst; Friede und Gewalt; Liebe, Spiritualität und Gott. Und gleichzeitig habe ich das spätere Gespräch darüber beim Schreiben immer schon mitgeträumt.
Komplettes Interview lesen
Gab es für Ihr Schreiben einen bestimmten Auslöser?
M. R.: Die Pandemie. Bücher, wie ich sie zuvor geschrieben hatte, die sich eingehend mit Kultur und Lebensweise anderer Regionen wie Griechenland oder dem Baltikum beschäftigen, waren mangels Mobilität plötzlich nicht mehr möglich. Zugleich sah ich mich wie viele andere auch zurückgeworfen auf existenzielle Grundfragen, angefangen damit, dass ein ganz nahestehender lieber Mensch auf einmal ungewollt zur tödlichen Bedrohung werden konnte. Die ganze Normalität des Zusammenseins war von einem Tag auf den anderen ausgebremst. So wollte ich festhalten, wo ich innerlich stehe, sozusagen kleine Testamente für alle Fälle.
Der Untertitel »Essays und Gedichte« verrät, dass Sie sich Ihren Themen auf zwei Wegen nähern. Wie habe ich mir diesen Schreibprozess vorzustellen?
M. R.: Gedichte schreibt man, wenn sie kommen, also nicht zentriert auf bestimmte Buchkapitel. Aber allmählich entstand eine Struktur, welche eine Zuordnung ermöglichte. Die Themen der meisten Essays lagen praktisch auf der Hand, und nach dem Einstieg ins Buch habe ich tatsächlich mit dem Text über Pandemie, Klimawandel und Demokratie begonnen. Wenn sich durch die Nachrichtenlage etwas Neues ergab, wurde das immer wieder ins Buch eingearbeitet. Wichtig war mir bei einem so umfangreichen Text, dass jedes Kapitel einzeln für sich gelesen und verstanden werden kann, obwohl ich mir bei der Reihenfolge der Texte im Buch natürlich etwas gedacht habe. Per aspera ad astra, vom Dunkeln ins Licht sozusagen. Das war und ist ja unser aller Hoffnung.
Was liegt zurzeit auf Ihrem Schreibtisch? Arbeiten Sie schon an einem neuen Band?
M. R.: Buchstäblich seit dem ersten Tag des Ukraine Krieges – die Texte sind chronologisch datiert – verfasse ich Gedichte dazu. Ich schreibe mir dabei die schrecklichsten Bilder und Meldungen buchstäblich von der Seele. Sie lassen mich erst los, etwa nachts den Schlaf erst zu, wenn ich sie in einen gültigen, formal wie inhaltlich gereiften Text umgewandelt habe: als hätte ich aus Minus Plus gemacht, das Böse durch einen gelungenen Text entmachtet. Das ist auch ein tiefenpsychologischer, persönlich heilsamer und heilender Vorgang. Ich hoffe, anderen wird es später genauso gehen, wenn sie diese Texte zu lesen bekommen. Man kann mit einigem Training ganz Aktuelles – und sei es noch am selben Tag – so verarbeiten, dass ein bleibender Text dabei entsteht. So entwickelt sich eine Art Kriegstagebuch, dessen notgedrungen oft sehr harte Gedichte ich noch durch kurze Prosaeinschübe ergänzen möchte, kurze Reflexionen darüber, was dieser Krieg mit uns allen macht. So kräftezehrend es ist, das Projekt erscheint mir wie ein unausweichlicher Auftrag.
Lieber Herr Roemer, was möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen?
M. R.: Ich wünsche mir viele Lesungen zu diesem Buch, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, damit wir gemeinsam nach Lösungen suchen, wie es weitergehen kann mit dieser Welt: Denn bei der Angst, welche die Häufung von Katastrophen wie Krieg, Klimawandel und Pandemie in uns erzeugt, dürfen wir ja nicht stehenbleiben. Und ganz aktuell wünsche ich mir sehr, dass meine Texte zum Ukraine-Krieg unter die Leute kommen: Damit meine Kunst anderen Menschen Kraft gibt, durchzuhalten hilft, wenn unsere freiheitliche Lebensform angegriffen wird. Am liebsten wäre es mir, jemand trüge sie, ins Ukrainische übersetzt, auf den dortigen Marktplätzen als Zeichen unserer Solidarität vor.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview einklappen
Martin Roemer im Interview zu seinem Buch »Zauberwelt«
Lieber Herr Roemer, in Ihrem neuesten Buch widmen Sie jeder Klaviersonate Beethovens ein eigenes Gedicht. In dem einleitenden Essay bezeichnen Sie Beethoven als »Lebensbegleiter«. Können Sie denjenigen, die Ihr Buch noch nicht kennen, sagen, woher diese starke Verbindung zu Beethoven stammt?
Martin Roemer: Ich habe einmal als junger Mann nach einer Lesung, zu der mich ein Freund mitgeschleppt hatte, einem recht fundamentalistischen christlichen Autor aus den USA eine präzise Frage gestellt, die mit der erhellenden Auskunft »Lesen Sie mein Buch« beantwortet wurde. Diese Replik erhalten Sie von mir selbstverständlich nicht. Aber aufmerksame Leserinnen und Leser werden ohnehin schnell merken, wo im einleitenden Essay und bei manchen Gedichten diese Wahl erklärt und begründet wird. Mich hat als Kind im Elternhaus einfach diese Musik spontan angezogen und tief bewegt, zunächst vor allem natürlich einzelne eher bekannte Sonaten wie die Appassionata oder die sogenannte Mondscheinsonate. Die Sonaten bewirkten ein Gefühl von »Das ist größer als du, aber da möchtest du hin, und vielleicht gelingt dir das auch«. Sich in dieser Sphäre zu bewegen, griff weit über die Kindheit hinaus.
Komplettes Interview lesen
Irgendwo hörte damals im Kind unbewusst schon der künftige Erwachsene zu. Eine Lebenshaltung begann sich zu entwickeln, nicht im denkenden Kopf, sondern in Herz und Gehör, alle Sinne durchdringend. Belebendes Aufgewühltsein stellte sich ein, weil die Musik etwas riskierte und musikalisch die Dinge exakt auf den Punkt brachte. Dass ich dabei unterschwellig auch eigene innere Konflikte abreagiert habe, die mir damals nicht im Mindesten bewusst waren, kann ich erst heute an der Schwelle zum Alter realisieren. Mich hat die Direktheit und Ehrlichkeit in dieser Musik sofort überzeugt, und je mehr ich über Beethovens Lebenslauf las, desto mehr festigte sich die Überzeugung, diesem Werk könnte ich mich anvertrauen, denn es kennt zwar eine enorme emotionale Bandbreite und Tiefe, aber keinen doppelten Boden. Und diese Wahl hat mich nie enttäuscht, andere kamen hinzu, Bach oder Brahms zum Beispiel. Aber Beethoven trat nie zurück in die zweite Reihe. Manches brauche ich bei ihm nur kurz, für wenige Takte, zu hören, und bin sofort zu Hause – bei mir selbst. Und das ist etwas unglaublich Tröstendes, und in manchen Situationen geradezu eine mentale Erste Hilfe.
Beim Lesen fällt schnell auf, dass Ihre Gedichte durchkomponiert sind. Sie haben einen eigenen Takt, Hebungen und Senkungen, Motive, Schlussakkorde. Es gibt Dur-, aber auch Moll-Phrasen. Haben Sie beim Schreiben gleich eine Melodie im Kopf, oder wie gehen Sie hier vor?
M. R.: Viele Gedichte habe ich unmittelbar nach dem Hören der jeweiligen Sonate geschrieben, im Laufe der Sätze hatte sich dann ein Thema entwickelt, über das ich bei dieser Sonate schreiben wollte. Das konnte ganz nahe mit der musikalischen Struktur und jeweiligen Kompositionstechnik verflochten sein, sich also dem Verlauf der Sonate anschmiegen, konnte Bezug nehmen auf bestimmte Lebensstationen und -haltungen Beethovens, auf meine eigenen Assoziationen beim Hören zurückgreifen oder meine eigenen Erfahrungen mit Beethoven über die Jahrzehnte hin spiegeln. Auch prägende kindliche Eindrücke beim Spielen der Musik habe ich eingebaut: Das Wiederhören dieser prägenden Musik erlaubt ja auch eine Begegnung mit dem inneren Kind. Manche Gedichte waren ganz schnell »da«, andere mussten reifen. Immer war sehr schnell klar, welchem Rhythmus der Text folgen sollte, oft genug erschien als erstes ein rhythmisierter Kernsatz – ein Thema, dessen Verarbeitung das Gedicht oder ein Gedichtteil dienen würde. Letztlich war es ein Komponieren mit den Mitteln der Sprache und ihrer Klaviatur von Klängen. Wenn man das lange genug trainiert hat, hört man ganz genau, ob eine Phrase oder ein Satz klanglich, rhythmisch und von der Länge her stimmig sind. Bei diesem inneren Maßnehmen folge ich unwillkürlich auch einem mathematischen Kompass. Die Zahl der Hebungen und Senkungen ist keineswegs willkürlich. Wenn dem Gedicht eine bestimmte feste Taktung zugrunde liegt wie bei mir, macht es sehr wohl einen erheblichen Unterschied, ob es 59, 60 oder 61 Hebungen hat. Bei Gedichten, die ich spontan für abgeschlossen und fertig hielt, ergaben sich immer Hebungen in gut teilbaren und »runden« Proportionen. Bei 59 oder 61 stimmte dann etwas noch nicht ganz, bei 60 wurde der Lesefluss klanglich und atemtechnisch beim halblauten Vorlesen vollkommen angenehm. Und natürlich habe ich mich beim Schreiben, das haben Sie ganz richtig herausgehört, auch musikalischer Stilmittel bedient – etwa zu einem Schlussakkord gegriffen. Der Anfang des Gedichtes zu op. 110 »vertont« das Thema des ersten Satzes. Lesen die den Textbeginn laut: »Komm in meine Arme, komm, o komm, mein Lebensglück« – so ›klingt‹ dieses Thema, schwillt an und sinkt in einer sachten Kurve zurück. Dieser Satz, dieser Sehnsuchtsruf, erschien plötzlich, und nach einer Weile entwickelte sich aus ihm dieses Gedicht über Lebensrückblicke und Beethovens große, letztlich tragisch endende Liebe.
Am Ende des Buches befindet sich ein Glossar mit Erläuterungen zu musikalischen Fachbegriffen. Brauche ich für Ihre Gedichte eine musikalische Grundbildung, oder darf ich die Erläuterungen schlicht als Mehrwert ansehen?
M. R.: Sagen wir es so: Natürlich schreibt man mit Lyrik kein musikalisches Fachbuch, sondern vermittelt, mal etwas analytischer, mal rein assoziativ, gewisse seelische Stimmungen. Natürlich kann dann bei der Lektüre ein klein wenig musikalische Grundbildung nicht schaden, und für den Fall, dass der eine oder andere Begriff nicht präsent ist, habe ich daher dieses Glossar angehängt. Manchmal kommt man beim Schreiben über Musik eben ohne einen bestimmten Terminus nicht aus. Umgekehrt wollte ich all die in den musikalischen Fachbegriffen Bewanderten nicht dadurch nerven, dass ich für sie bloß Selbstverständlichkeiten erläutere. Deshalb habe ich, wo immer sich das anbot, einen Bezug auf das Oeuvre der Klaviersonaten eingebaut, der vielleicht die eine oder andere Information enthält, die auch für manche Beethoven-Kundige neu und bereichernd ist. Dann geht es eher um die Frage: Was bedeutet ein bestimmter Fachbegriff speziell bei Beethoven?
Ist dieses Buch auch für Lesende geeignet, die sich nicht in erster Linie für Lyrik, wohl aber für Beethoven interessieren?
M. R.: Natürlich, allein schon wegen des einleitenden Essays. Und dann lädt beim Lesen manches Gedicht vielleicht doch dazu ein, die eigenen Empfindungen und Erfahrungen mit denen des Autors zu vergleichen. Außerdem wird durch die Vielfalt der Gedichte und ihrer Gestaltung deutlich, was für ein reicher Kosmos uns mit diesen Werken anvertraut worden ist, wie modern auch vieles an diesem Komponisten ist. Man kann angesichts der Vielzahl der thematischen Bezüge, daran dass auch wirklich jede einzelne Sonate, ob kurz oder lang, vertreten ist, realisieren, dass die 32 Sonaten sämtlich zu Entdeckungsreisen einladen. Das gilt übrigens nicht nur für jene Gebiete, die durch die bekannten und viel gespielten Sonaten abgedeckt sind – auch wenn ich diesen Werken allesamt schwergewichtige Texte gewidmet habe. Nota bene: Viele Einsichten und Assoziationen lassen sich einfach mit den Mitteln der Lyrik viel besser ausdrücken als mit Prosa, weil das Gedicht parallel bei der textlichen Wiedergabe die klanglichen Stilmittel der Sprache geradezu ausreizt. Das wird dann, wenn es gelingt, eine Begegnung auf Augenhöhe.
Haben Sie eine Lieblingsklaviersonate von Beethoven?
M. R.: Nicht unbedingt die eine, die alle anderen weit überragt. Aber es gibt schon Sonaten, die ich besonders liebe und häufiger höre als andere. Bei der Appassionata und ihrem Höllenritt bin ich immer noch hin und weg und lausche ihr atemlos bis zum Schluss. Die Melancholie der ›Sturm‹-Sonate op. 31,2 rührt mich an, beim Variationssatz im abschließenden op. 111 finde auch ich mich in transzendenten Sphären wieder, wie das vielen anderen, die über diese Musik geschrieben haben, widerfahren ist. Und die As-Dur Sonate davor, op. 110, ein wahres ›per aspera ad astra‹-Werk, führt bei mir jedes Mal zu unglaublichen Glückgefühlen. Einfach eine kathartische Reinigung. Männer sollen nicht weinen? Das lernt man hier, nur dass die Art der Tränen sich während der Sonate wandelt. Mehr kann Musik nicht erreichen. Jetzt wissen Sie, warum dieses Buch entstanden ist. Das ihr gewidmete Gedicht war übrigens das allererste in der langen Reihe, und meine Frau meinte, ich sollte es auf diese Weise doch einmal auch mit allen anderen versuchen. Also, wie Sie sehen, meine gute und kluge Lebensbegleiterin.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview einklappen
Martin Roemer im Interview zu seinem Buch »Baltische Rhapsodie«
Lieber Herr Roemer, das Baltikum mit seiner unberührten Natur und seiner teilweise unbekannten Kultur wird für Reisende zurzeit immer beliebter. Was hat Sie ins Baltikum geführt? Haben Sie eine persönliche baltische Rhapsodie? (Gab es für das Schreiben Ihres Buches einen besonderen Auslöser?)
Martin Roemer: Wie im Buch erwähnt, habe ich ebenso wie meine Frau keine Vorfahren aus dem Baltikum. Baltikum war ihr Reisevorschlag, dem ich sofort zugestimmt habe, weil ich den Übergang von kulturell wie landschaftlich vertrautem Terrain zu den Denk- und Lebensweisen Osteuropas faszinierend finde. Trotz etlicher Vorkenntnisse war ich überrascht, wie sehr man sich dennoch in die Historie dieses Landstrichs vertiefen muss, um nicht oberflächlich zu bleiben. Letztlich war es das Einstimmen in den Takt der Natur, ein Gefühl des Eins Werdens, das mich zum Schreiben gebracht hat. Dabei konnte ich auf Erfahrungen mit meinem ähnlich konzipierten Buch über Griechenland zurückgreifen. Wenn dann wie hier die Stille ihr innerer Ausgangspunkt ist, dann fällt der Kontrast zur blutigen Geschichte des Baltikums umso eher auf: Sie stehen in einem kleinen Paradies und werden gewahr, was der Mensch dem Menschen angetan hat. In den Wunden der herrlichen Altstadt von Vilnius wird der Holocaust sogar optisch spürbar: Geht man zudem abends im Regen hindurch, begegnet das innere Auge unweigerlich den Toten. Ich jedenfalls kann gar nicht anders, als auch sie einzuladen in so ein Buch. Das gehört zur Ehrfurcht des Reisenden dazu. Und da haben sie in dieser Spannweite zwischen Trauer und Glück meine ganz persönliche baltische Rhapsodie.
Komplettes Interview lesen
Baltische Rhapsodie ist der Titel Ihres Werkes, das sich auf den ersten Blick auf die von Ihnen gewählte Form der Lyrik bezieht. Besteht ein (formaler, sprachlicher, …) Zusammenhang mit den Essays in diesem literarischen Reiseführer?
M. R.: Die Titelgebung verweist auf die Lyrik, aber auch auf das notwendig Unabgeschlossene, Improvisierte eines solchen Unterfangens: Man kommt nicht überall hin, kann nicht alles erwähnen. Und ein Rhapsode erzählt auch immer von Begebenheiten aus ferner Zeit, was man gerade hier tun muss, da baltische Geschichte nun wirklich nicht allen vertraut ist. Es gibt in der Tat auch einen sprachlich-formalen Zusammenhang mit der Form des rhapsodischen Berichtens: Die Gedichte sind sämtlich durchrhythmisiert, und hat man diesen Rhythmus entdeckt, führt er einen durch den Text. Das habe ich auf einige der Essays übertragen. Je meditativer sie sind – also die Abschnitte über Küste, Wälder und Seen etwa –, desto strenger halten sie sich daran. Auch der Essay über die amputierte Altstadt von Vilnius folgt diesem Prinzip, wobei dort, wo vom schnellen Takt des Mordens berichtet wird, für einen Absatz der Rhythmus wechselt und sich der Takt beschleunigt. In den Texten zur Historie ist der sprachliche Duktus freier. Mit der seelischen Vertiefung dringt gewissermaßen Lyrik in die Prosa ein.
Sie sagen, dass Sie in Ihrem Buch versucht haben, mit dem Tempo der inneren Reise, dem ruhigen Charakter der baltischen Landschaft gerecht zu werden. Können Sie diese Verbindung zwischen Landschaft und Lektüre genauer beschreiben?
M. R.: Die soeben erwähnte rhythmisierte Prosa soll andeuten, dass die Seele in dieser Landschaft ihren inneren Takt gefunden hat, und wenn dieser Rhythmus dann in den entsprechenden Essays mit kleinen Variationen jeweils durchläuft, könnte das wie ein ruhiges Ein- und Ausatmen wirken, Entschleunigung auch in der Art des heute oft hektischen Lesens. Am Ufer eines nahezu menschenleeren Sees zu sitzen, beschützt durch das nahtlose Grün ringsum, durch einen unendlich scheinenden riesigen Wald zu streifen, ohne sich in der Natur auch nur im mindesten bedroht zu fühlen, selbst wenn es dunkel wird, und dem Gleichmaß eines Küstensaums zu folgen: All das sind auch Atemmeditationen, bei denen man durchlässig wird für das Geheimnis unserer nicht einsamen, sondern verbundenen Existenz.
Aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen durch zahlreiche Reisen und Lektüren ist Baltische Rhapsodie ein idealer literarischer Reisebegleiter, um die Schönheit und Wunder des Baltikums zu entdecken und die typischen Reiseführer zu ergänzen. Haben Sie eine favorisierte Reiseroute durch das Baltikum?
M. R.: Auch im Nachhinein hat sich der von meiner Frau und mir seinerzeit gewählte Weg als recht sinnvoll erwiesen. Der Beginn war dadurch markiert, dass wir die Fähre von Kiel nach Klaipeda genommen haben, was eine geruhsame Anreise mit dem eigenen PKW ermöglicht. Wir sind dann gleich über den Berg der Kreuze nach Riga weitergefahren, weil wir mit der größten Stadt des Baltikums beginnen wollten. Von dort aus sind Kap Kolka, der Gauja-Nationalpark mit Cesis sowie Schloss Rundale südlich von Jelgava in Tagesausflügen gut erreichbar. Danach haben wir uns einige Tage in Tallinn gegönnt mit einer Exkursion in das Lahemaa-Reservat. Nach zwei Quartieren in Städten folgten zwei längere Aufenthalte in der Natur: ein Blockhaus am Vörtsjärv-See in Zentralestland mit Abstechern nach Tartu und zum Peipus-See, anschließend ein hübsches Holzhaus in Baltini ganz im Osten Lettlands. Beginnt man im Westen und fährt über die jeweils östlichen Landesteile der drei Staaten zurück, hat das den Vorteil, dass man im zweiten Teil der Reise in der Weite der Natur zur Ruhe kommen kann. Der Osten ist jeweils noch stiller, dabei hügeliger und seenreicher, die Wälder, wenn man so sagen darf, noch verwunschener. Nachdem wir uns Vilnius angeschaut hatten, sind wir noch einmal für einige Tage in der Nähe des Aukstaitija-Nationalparks „verschwunden“. Da wollte ich, innerlich angekommen, dann gar nicht mehr weg, trotz eines Ausflugs nach Kaunas. Wenn man vor der Rückkehr dann noch die Kurische Nehrung aufsucht, wo man Reste des Flairs aus der vergangenen deutschen Zeit erspüren kann, ist das eine ganz gute Vorbereitung auf die unvermeidliche Rückkehr. Natürlich gibt es Alternativen, aber ich kann nur empfehlen, es nicht bei Städtetouren bewenden zu lassen, sondern sich Zeit zu nehmen, um sich gerade in den östlichen Landschaften ebenso zu verlieren wie zu finden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview einklappen